Bilder zum Stück
Aktuelles Stück
Wie alles anfing... Gedanken zum "Dickicht der Städte" und unserer Inszenierung
Brechts Drama zeigt die moderne Stadt als Überlebenskampf, in ihrer Unübersichtlichkeit und der Verwobenheit aller Einwohner. In der Zeit seiner Entstehung (1923, zweite Fassung 1927) entwarf es das Bild einer - gewaltsam aufrechterhaltenen -
Geschlechterordnung, die die Strukturen der Städte bis in ihre symbolischen Verästelungen hinein prägte. Die Kämpfenden
waren Männer - ihre Frauen, Schwestern, Töchter waren Opfer, Spieleinsatz.
Unsere Inszenierung sieht diesen zweiten Schwerpunkt ein wenig anders, aktueller. In einer Zeit, in der Frauen in
höchste Staatsämter und leitende Positionen in der Wirtschaft vordringen, wird der zentrale Zweikampf zwischen einer
Frau und einem Mann ausgefochten. Und er wird nicht in erster Linie als Geschlechterkampf ausgefochten, sondern als
Machtkampf in Zeiten einer globalisierten, immer unerbittlicher werdenden Warengesellschaft, welche die Charaktere
formt und verformt, ihrer menschlichen Vielfalt beraubt. Schon Brecht, der zum Zeitpunkt der ersten Fassung des
Stücks die Schriften von Karl Marx noch nicht gelesen hatte, sah in den Großstädten der Weimarer Zeit menschliche
Beziehungen, geprägt von Konkurrenzkampf und Korruption, von Isolation, Anonymität und Instrumentalisierung des
jeweils Schwächeren.
In seinem Verstehen wollen ging Brecht geradezu handwerklich vor - er verglich das Neue mit Bekanntem und versuchte
es sich anfangs so zu erklären: Im Kampf zweier Konkurrenten sah er anfänglich
Ähnlichkeiten mit einem Boxkampf,
seinem Verlauf, den Strategien der Kämpfer, dem Ergebnis - Sieg oder Niederlage. Das Stück erhält dadurch seine
untergründige Spannung - wer gewinnt die nächste Runde, wer kann den Kampf vielleicht noch weiter eskalieren?
Mancher Betrachter mag sich auch an die Züge eines Schachspiels - auf Leben und Tod freilich Ð erinnert fühlen.
Doch schon während des Schreibens sah Brecht, dass der Boxring gleichsam gesprengt werden musste, das Umfeld der
Kämpfer wird unerbittlich mit einbezogen, die Kämpfenden verändern sich während des Kampfes.
Im Aufbau der Handlung, die er in die USA, in das Chinatown von Chicago verlegt hat, arbeitet der Autor mit dem
Kontrastprinzip: Ein Mann vom Land, "aus der Savanne", kommt mit seiner Familie (seiner Schwester Marie ,
den Eltern Mae und John ) in die Stadt und erwartet anderes: Kultur, Bildung, geistige Bereicherung - und
so hat er, George Garga , sich eine Anstellung als Leihbibliothekar gesucht, liest mit rasender Hast und
Leidenschaft Buch um Buch und ist dabei zufrieden. Eines Tages betritt eine Gruppe zwielichtiger Geschäftsleute
die Leihbibliothek (Skinny , die Privatsekretärin Shlinks; J. Finnay , genannt der Wurm, ein Hotelbesitzer;
Collie Couch , genannt der Pavian, ein Zuhälter), angeführt von einer Holzhändlerin namens C. Shlink , und
will ihm seine Meinung über ein Buch abkaufen. George ist arm, schläft mit seiner Familie neben geplatzten
Abflussrohren, was ihm prompt Vorwürfe wegen seines Körpergeruchs einträgt - aber klare Ansichten hat er und
die will er sich um nichts in der Welt abkaufen lassen. So beginnt der Kampf...
Der Streit hat zunächst die Demolierung des Ladens und die Entlassung Gargas zur Folge. Doch die Auseinandersetzung
zwischen beiden steigert sich, eskaliert und nimmt monopolyhafte Zuege an. Beide beziehen ihre gesamte Existenz
wie auch - im Fall Gargas - die ihrer Familienangehörigen in den Kampf ein. Am Ende stirbt die lange
überlegene
Shlink durch Selbstmord. Der anfänglich naive, ethischem Handeln verpflichtete Bibliotheksangestellte jedoch
hat eine neue Mentalität und Kampfesformen erlernt und wendet sich der nächst größeren Stadt zu - New York.
Tragische Figuren, in deren teils komischen Begrenztheiten sich jeder von uns - 'mal hier, 'mal dort - wieder erkennt,
gibt es zuhauf:
Da ist Georges Braut Jane , die sich vernachlässigt fühlt, daraus aber die falschen Schlüsse zieht und ihrem sozialen
Abstieg unaufhaltsam entgegengeht.
Anrührender noch Marie, die Gefühle investiert und fehl investiert, ihren Bruder auf dem Weg der Moral zu halten sucht
und schließlich - aller Illusionen beraubt - froh ist, bei einem Mann (Manky), den sie nicht liebt, unterzukommen.
Schließlich die Protagonisten: C. Shlink ist mit allen Wassern der Konkurrenzgesellschaft gewaschen, aber unfähig zu
Liebe und Mitmenschlichkeit. Sie kann Beziehungen nur als Kampfbeziehungen führen und in George Garga erkennt sie
einen ebenbürtigen Kämpfer - doch dieser versteht das seltsame Beziehungsangebot nicht. Shlink schenkt ihm ihren
Holzhandel, um Waffengleichheit herzustellen, doch George, der Idealist, gibt die Immobilie gleich an die Heilsarmee
weiter - was soll er damit, denkt er, zumindest noch in diesem Stadium... Doch dann lernt er von Shlink, leider das
Falsche, die Mittel und Tricks sich in der Konkurrenzgesellschaft nach oben zu boxen; gleichwohl erkennt er die Kälte
des Wegs, der vor ihm liegt und schließt mit den Sätzen: "Allein sein ist eine gute Sache. Das Chaos ist aufgebraucht.
Es war die beste Zeit."
Tragik darf noch ausgespielt werden, Brechts "episches Theater" ist erst in Ansätzen vorhanden.
Deshalb ein Stück, das unter die Haut gehen darf und geht - hoffentlich!
Dr. Hans-Peter Goldberg, November 2008
1 Laura Weber
2 Antonia Meiritz
3 Jens Soeterboek
4 Niklas Goldberg
5 Annika Hollmann
6 Valentin Goldberg
7 Adrian Haardt
8 Jana Remus
9 Neslihan Erkal
10 Jochen Strohm
Bilder zum Stück
|
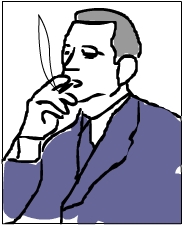 |