|
|
Premierenbericht der „Heidenheimer Zeitung“ vom 18. November 2008
_________________
Alter Text, zeitnahes Theater
„Schillers Freu(n)de" beeindrucken sehr mit Bertolt Brechts „Im
Dickicht der Städte"
Zwei „Im Dickicht der Städte": Jana Remus und Niklas Goldberg.
Foto: ube
„Schillers Freu(n)de" spielen Bertolt Brecht. Ja, bei der Kombination kann ja
eigentlich gar nichts mehr schief gehen. Und es ging auch nichts schief, wie
die Zuschauer bei der Premiere der Theater-AG des Heidenheimer
Schiller-Gymnasiums im WCM-Gebäude feststellen konnten. Zumal sich die Schüler
rund um Mentor und Regisseur Dr. Hans-Peter Goldberg mit dem „Dickicht der
Städte" ein frühes und wildes Brecht-Stück herausgesucht hatten, mit dem der
Augsburger Schwabe nach eigenem Vernehmen und in der ihm eigentümlichen
Bescheidenheit ,;Schillers Räuber endlich verbessern wollte".
Und zwar, um „einen großen Fehler sonstiger Kunst zu vermeiden: ihre Bemühung
mitzureißen." Ja, bei der Direktive kann ja eigentlich auch nichts mehr schief
gehen. Ging es aber, wie die Schüler unter Beweis stellten. Brechts Vorhaben
mit seinen Stücken, nicht mitreißen zu wollen, hat sich offenkundig erst bei
späteren Werken durchgesetzt. Hier ist die Sprache noch völlig ununiformiert,
ungebärdig und teilweise - das Stück entstand im Jahre 1922 - noch
expressionistisch zerfetzt. Hier wehrt sich noch ein protestantisch geprägter
Plärrer-Fan gegen den modernen Großstadtkapitalismus, und zwar nicht wie später
mit Marx-
und Engelszungen, sondern durchaus in der Tradition der deutschen Metaphysik,
dem Weltekel.
Goldberg und seine Schüler; allen voran in den Hauptrollen Niklas Goldberg als
George Garga, Laura Weber als dessen Schwester Marie und Jana Remus als Shlink,
legen den Akzent ihrer Inszenierung ganz auf die Physis. Die Anordnung der
Körper auf der Bühne, ihr Kontext spielt eine entscheidende Rolle bei der
Umsetzung der Brechtschen Sprachmagie, die - ganz wie die Räuber - aus einem
rebellierenden Herzen zu stammen scheint, weniger denn aus einem
gesellschaftsanalytischen Kopf.
Die Idee, nebenbei bemerkt, die Rolle eines alten, verschrumpelten malaiischen
Holzhändlers antigeschlechts-spezifisch mit einer jungen deutschen Blondine zu
besetzen, ist an sich schon großartig, gibt der Inszenierung aber noch eine
zusätzliche Note, indem sie den von ausbeuterischen Verhältnissen geprägten
Geschlechterkampf, der ohnehin bereits rund um den Körper der Marie tobt, die
vom ehrbaren Mädchen zur Dirne absteigt, nicht doppelt, sondern
die ganze Liederlichkeit des Menschen nicht nur den Verhältnissen zuschiebt, in
denen er leben muss, sondern der Existenz selbst, die eine brüchige geworden
ist.
So fühlt man sich bei der Inszenierung - nicht zuletzt wegen der stark
expressionistischen Sprache - das ein oder andere Mal unwillkürlich an Brechts
großen Antipoden Gottfried Benn
erinnert, der hier den Akteuren mit einem reaktionären Grinsen über die
Schulter zu blicken scheint: „Die Armen wollen hinauf, die Reichen nicht
herunter. Schaurige Welt, kapitalistische Welt. Aber machen kann man da
nichts." Denn das „Dickicht der Städte" erweist sich bei „Schillers Freu(n)den“
als geradezu undurchdringlich. Chicago hin oder her: keiner kommt hier lebend
raus, auch nicht in Heidenheim.
Verrückt ist es schon, wie aktuell und zeitnah dieses Stück im Lichte von
„Schillers Freu(n)den" erscheint. Die Inszenierung jedenfalls ist - wie immer
bei Goldberg - bis in die Details hinein durchdacht. Und auch die jungen
Schauspieler zeigen durch ihr Engagement, dass sie dieser bald hundert Jahre
alte Text unmittelbar etwas angeht. Könnte es sein, dass Brecht hier etwas
angerührt hat, das uns zu Beginn dieses Jahrhunderts noch schonungsloser
entgegensteht?
Holger Scheerer
|
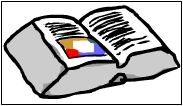 |
|